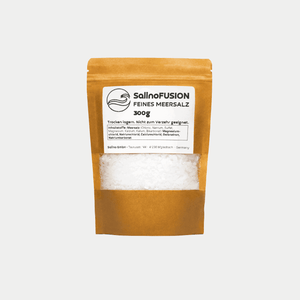An einem klaren Novembermorgen im Jahr 2025 steht Maria K. am Fenster ihrer Wohnung in Jänschwalde und blickt auf die Kühltürme des Kraftwerks. Noch laufen sie, aber nicht mehr lange. Die Luft ist besser geworden, sagt man. Die Messstationen zeigen es. Doch wenn Maria morgens aufwacht, spürt sie immer noch diese Enge in der Brust. Der Husten, der nie ganz weggeht. Die Kurzatmigkeit beim Treppensteigen. Sie ist 52 Jahre alt und lebt seit ihrer Geburt hier. Ihre Lunge erinnert sich – an jeden Atemzug der letzten Jahrzehnte.
Die Lausitz heute ist eine Region im Umbruch. Die Luftqualität verbessert sich messbar, die Emissionen sinken, die Zukunft soll grün werden. Doch in den Arztpraxen, in den Lungenfachkliniken, in den Wartezimmern der Physiotherapeuten erzählt sich eine andere Geschichte. Die Geschichte von Menschen, deren Körper das unsichtbare Erbe der Kohle tragen – heute, jetzt, in diesem Moment.
Die Luft von heute: Besser, aber nicht gut genug

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Luftqualität in der Lausitz hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich verbessert. Schwefeldioxid-Konzentrationen sind um über 80 Prozent gesunken, Stickoxide um etwa 60 Prozent. Die Grenzwertüberschreitungen, die in den 1990er und 2000er Jahren fast alltäglich waren, gehören weitgehend der Vergangenheit an. Das Umweltbundesamt bestätigt: Die akute Belastung durch klassische Kraftwerksemissionen nimmt kontinuierlich ab.
Doch „besser" bedeutet nicht „gut". Auch heute noch liegen die Feinstaubwerte in einigen Teilen der Lausitz über dem bundesweiten Durchschnitt. Besonders im Winter, wenn Inversionswetterlagen die Schadstoffe am Boden halten, steigen die PM10- und PM2,5-Werte bedenklich an. An etwa 20 bis 30 Tagen im Jahr werden die Grenzwerte überschritten – nicht dramatisch oft, aber für Menschen mit vorgeschädigten Lungen oft genug.
Die Tagebaue sind noch aktiv. Welzow-Süd, Nochten, Jänschwalde – sie fördern weiter Braunkohle, und mit jeder Tonne entstehen Staubemissionen. Moderne Beregnungsanlagen und Staubbindungsmaßnahmen reduzieren die Belastung, aber eliminieren sie nicht. An windigen Tagen weht der feine Staub noch immer über die umliegenden Ortschaften.
Was die Messungen nicht zeigen
Die offiziellen Messstationen erfassen nur einen Teil der Realität. Sie stehen an festgelegten Punkten, messen Durchschnittswerte, bilden Trends ab. Was sie nicht zeigen: die lokalen Spitzen, wenn der Wind ungünstig steht. Die Belastung direkt am Tagebaurand, wo keine Messstation steht. Die individuellen Expositionen der Menschen, die dort arbeiten oder in unmittelbarer Nähe wohnen.
Anwohner berichten noch heute von Tagen, an denen sie ihre Fenster geschlossen halten, an denen eine sichtbare Staubwolke über den Ort zieht, an denen das Auto innerhalb von Stunden wieder grau ist. Diese Erfahrungen finden sich nicht in den Statistiken, aber sie sind real – und für die Atemwege belastend.
In den Praxen der Region: Was Ärzte heute sehen

Dr. Thomas Weber ist Pneumologe in Cottbus. Seine Praxis liegt im Herzen der Lausitz, und was er täglich sieht, bestätigt die Zahlen der Gesundheitsstatistiken: „Die Prävalenz chronischer Atemwegserkrankungen ist hier deutlich höher als im Bundesdurchschnitt. COPD-Patienten, die nie geraucht haben. Asthmatiker, deren Erkrankung ungewöhnlich schwer verläuft. Lungenfibrose-Fälle, die wir eigentlich nur bei älteren Patienten erwarten würden."
Die aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts zeigen: In den Landkreisen Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und Görlitz liegt die Rate diagnostizierter COPD-Fälle bei Menschen über 50 Jahren um 15 bis 20 Prozent über dem deutschen Durchschnitt. Asthma bei Kindern und Jugendlichen ist ebenfalls überdurchschnittlich häufig – trotz verbesserter Luftqualität.
„Das Paradoxe ist", erklärt Dr. Weber, „dass wir heute die Folgen von gestern behandeln. Die Luft wird besser, aber die Lungen der Menschen tragen die Last von 40, 50 Jahren Belastung. Und diese Last lässt sich nicht einfach wegtherapieren."
Die Generation der Chronisch-Kranken
In den Wartezimmern sitzen Menschen wie Maria K. – Anfang bis Mitte 50, die ihr gesamtes Arbeitsleben in der Region verbracht haben. Viele arbeiteten im Tagebau, in den Kraftwerken, in zuliefernden Betrieben. Andere lebten einfach nur hier, atmeten dieselbe Luft, Tag für Tag, Jahr für Jahr.
Heute sind sie Patient:innen. Sie kommen zu regelmäßigen Lungenfunktionstests, holen Rezepte für Kortison-Sprays und Bronchodilatatoren ab, besprechen ihre Sauerstoffsättigung, ihre Belastbarkeit im Alltag. Manche brauchen bereits Langzeitsauerstofftherapie – mit Anfang 60. Ihre Diagnosen ähneln sich: chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), oft kombiniert mit chronischer Bronchitis, manchmal mit Lungenemphysem.
Die Krankenversicherungsdaten zeigen einen klaren Trend: Die Verschreibungen von Atemwegsmedikamenten liegen in der Lausitz deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Auch die Hospitalisierungsrate aufgrund akuter Exazerbationen – also plötzlicher Verschlechterungen – chronischer Atemwegserkrankungen ist erhöht.
Kinder heute: Zwischen Entlastung und Erbe
Die gute Nachricht: Kinder, die heute in der Lausitz geboren werden, atmen deutlich sauberere Luft als ihre Eltern und Großeltern. Die Asthmaraten bei Neugeborenen und Kleinkindern zeigen seit etwa 2015 einen leicht rückläufigen Trend. Kinderärzte berichten, dass schwere Asthmaanfälle seltener werden, dass weniger Kinder dauerhaft auf Medikamente angewiesen sind.
Doch ganz entkommen die jungen Menschen dem Erbe nicht. Studien zur Lungengesundheit zeigen: Auch heute noch ist die Lungenfunktion von Jugendlichen in der Lausitz im Durchschnitt leicht reduziert im Vergleich zu Gleichaltrigen aus unbelasteten Regionen. Die Unterschiede sind nicht dramatisch, aber messbar – etwa 3 bis 5 Prozent weniger Vitalkapazität.
Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren – also diejenigen, die ihre ersten Lebensjahre noch in Zeiten höherer Belastung verbrachten. Ihre Lungenentwicklung fand in einer Phase statt, als die Luftqualität zwar bereits besser wurde, aber noch nicht gut war. Diese Kohorte trägt eine Art „Mittelposition" im Erbe der Kohle.
Sport als Herausforderung

Lehrer in den Schulen der Region berichten von einer Besonderheit: Bei Ausdauertests schneiden Schüler:innen hier tendenziell schlechter ab als in anderen Regionen. Nicht weil sie unsportlicher wären, sondern weil ihre Lungen weniger leisten können. Beim 800-Meter-Lauf, beim Dauerlauf im Sportunterricht zeigt sich, dass einige schneller außer Atem sind, schneller aufgeben müssen.
Für betroffene Jugendliche ist das mehr als nur eine schlechte Note. Es ist eine ständige Erinnerung daran, dass ihr Körper anders funktioniert. Dass sie nicht mithalten können, obwohl sie sich anstrengen. Dass etwas in ihnen nicht stimmt – etwas, wofür sie nichts können.
Der Alltag mit geschädigter Lunge: Leben in der Lausitz 2025
Wie lebt es sich heute in der Lausitz mit einer chronischen Atemwegserkrankung? Die Antwort hängt vom Schweregrad ab. Leichte COPD oder kontrolliertes Asthma sind mit Medikamenten oft gut zu managen. Betroffene führen ein weitgehend normales Leben, müssen nur bei körperlicher Anstrengung vorsichtig sein und in der Pollensaison oder bei Infekten aufpassen.
Doch es gibt auch die schweren Fälle. Menschen wie Jürgen M., 64 Jahre alt, ehemaliger Tagebauarbeiter. Er hat COPD im Stadium 4 – das schwerste Stadium. Sein Alltag ist stark eingeschränkt. Morgens braucht er 20 Minuten, um sich anzuziehen, weil jede Bewegung ihn außer Atem bringt. Einkaufen geht nur mit Rollator und Sauerstoffgerät. Treppensteigen ist unmöglich geworden.
„Die Luft hier mag besser sein als früher", sagt er, „aber für meine Lunge kommt das zu spät. Die ist durch. Fertig."
Wenn jeder Atemzug zählt
Für Menschen mit schweren Atemwegserkrankungen ist jeder Tag ein Balanceakt. Erkältungen können lebensbedrohlich werden. Ein grippaler Infekt, der für gesunde Menschen lästig ist, kann für sie zur Pneumonie führen, zum Krankenhausaufenthalt, zur lebensbedrohlichen Exazerbation.
Die Corona-Pandemie hat das besonders deutlich gemacht. In der Lausitz war die Angst unter Lungenkranken besonders groß – zu Recht. Die Hospitalisierungsrate bei COVID-19 lag in der Region überdurchschnittlich hoch, auch die Sterblichkeit unter Infizierten mit Vorerkrankungen war erhöht. Für viele war und ist es ein Gefühl permanenter Bedrohung.
Auch heute, im November 2025, gibt es noch Menschen in der Region, die kaum noch das Haus verlassen. Nicht aus Angst vor Corona allein, sondern aus Angst vor allem, was ihre Lunge zusätzlich belasten könnte. Vor Pollen, vor kalter Luft, vor Infekten, vor Anstrengung.
Was sich verbessert hat – und was nicht
Der Strukturwandel bringt messbare Verbesserungen. Seit der schrittweisen Stilllegung der Kraftwerksblöcke sinken die Emissionen kontinuierlich. Kraftwerk Jänschwalde hat mehrere Blöcke bereits vom Netz genommen, Schwarze Pumpe wird folgen. Mit jedem Block, der abgeschaltet wird, reduziert sich die Belastung durch Schwefeldioxid, Stickoxide und Quecksilber.
Die Renaturierung der Tagebaue zeigt erste Erfolge. Begrünte Flächen binden Staub, junge Wälder beginnen zu wachsen, Windschutzpflanzungen reduzieren die Verwehung von Partikeln. An Tagen mit gutem Wetter ist die Luftqualität heute oft auf einem Niveau, das mit anderen ländlichen Regionen Deutschlands vergleichbar ist.
Auch das Gesundheitssystem hat sich angepasst. Es gibt mehr Lungenfachärzte in der Region als früher, spezialisierte Reha-Einrichtungen für Atemwegserkrankungen, Selbsthilfegruppen, Lungensportgruppen. Die medizinische Versorgung ist besser geworden – was angesichts der hohen Zahl an Betroffenen dringend nötig war.
Die unsichtbare Belastung bleibt

Was sich nicht verbessert hat: die Lungen der Menschen. Das bereits geschädigte Gewebe regeneriert sich nicht. Vernarbungen bleiben. Entzündungsprozesse werden chronisch. Die Lungenfunktion, die verloren ging, kommt nicht zurück.
Auch die psychische Belastung ist enorm. Viele Betroffene berichten von Depressionen, von Angststörungen, von einem Gefühl der Ohnmacht. „Man hat das Gefühl, dass man für etwas bestraft wird, für das man nichts kann", sagt eine 49-jährige Asthmatikerin aus Welzow. „Ich bin hier geboren, habe hier gelebt, und jetzt zahle ich den Preis dafür."
Die Anerkennung als berufsbedingte Erkrankung ist schwierig. Nur wer nachweisen kann, dass die Exposition am Arbeitsplatz stattfand, hat eine Chance auf Entschädigung. Anwohner, die „nur" hier gelebt haben, gehen meist leer aus. Die Kausalität zwischen Umweltbelastung und individueller Erkrankung ist juristisch schwer zu beweisen.
Wie Menschen heute mit ihren Lungen umgehen
Die Sensibilität für Atemwegsgesundheit ist in der Lausitz heute größer als anderswo. Menschen achten auf Wetterberichte, nicht nur wegen Regen oder Sonne, sondern wegen der Luftqualitätsprognosen. Apps wie „Luftqualität" oder regionale Warnsysteme werden intensiv genutzt. An Tagen mit hoher Feinstaubbelastung bleiben viele Betroffene drinnen, meiden körperliche Anstrengung.
Luftreiniger in Wohnungen sind verbreitet. Viele Haushalte haben inzwischen Geräte angeschafft, die Feinstaub und Allergene filtern. Besonders in der Heizsaison, wenn durch Kaminöfen zusätzliche Partikelbelastung entsteht, laufen diese Geräte auf Hochtouren.
Auch Atemtechniken und Lungensport haben Einzug gehalten. Physiotherapeuten bieten spezielle Kurse an, in denen Betroffene lernen, wie sie ihre verbleibende Lungenkapazität optimal nutzen können. Die Lippenbremse, das Atemerleichternde Positionen, dosierte Belastung – Techniken, die den Alltag erleichtern.
Inhalation als Ritual

Inhalationstherapie ist für viele Betroffene Teil des täglichen Rituals geworden. Morgens und abends der Vernebler mit Kochsalzlösung oder Medikamenten. Manche nutzen zusätzlich Salzinhalatoren, um die Schleimhäute feucht zu halten und die Selbstreinigung der Bronchien zu unterstützen.
In diesem Kontext haben sich auch Mini-Salinen als ergänzende Maßnahme etabliert – kleine Gradierwerke für den Heimgebrauch, die feinen Salznebel versprühen. Sie sind kein Medizinprodukt und ersetzen keine Therapie, aber für Menschen mit gereizten Schleimhäuten können sie eine sanfte Unterstützung im Alltag bieten. Besonders in den Wintermonaten, wenn die Heizungsluft die Atemwege zusätzlich belastet, nutzen einige Betroffene solche Geräte, um das Raumklima atemfreundlicher zu gestalten.
Die Zukunft der Lungen: Was kommt nach der Kohle?
Die Lausitz wird 2038 kohlefrei sein – vielleicht früher. Die Kraftwerke werden stillgelegt, die Tagebaue geschlossen, die Rekultivierung abgeschlossen. Die Luft wird sich weiter verbessern, die Emissionen werden auf ein Minimum sinken. Für die kommenden Generationen ist das eine gute Nachricht.
Für die Menschen, die heute mit den Folgen leben, ändert das wenig. Ihre Lungen werden nicht gesünder, weil die Kraftwerke abgeschaltet werden. Ihre COPD verschwindet nicht, ihr Asthma heilt nicht. Sie werden weiterhin Medikamente brauchen, Sauerstoffgeräte, Therapien. Sie werden weiterhin zu Kontrolluntersuchungen gehen, bei jeder Erkältung bangen, bei jedem Infekt fürchten müssen, dass es schlimmer wird.
Die medizinische Forschung arbeitet an neuen Therapien. Biologika, die gezielt Entzündungsprozesse hemmen. Regenerative Ansätze, die Lungengewebe reparieren könnten. Doch diese Therapien sind teuer, oft noch experimentell, für viele Betroffene nicht zugänglich.
Was realistisch ist: Eine Stabilisierung. Verhindern, dass es schlimmer wird. Die verbleibende Lungenfunktion erhalten. Und hoffen, dass zumindest die nächste Generation aufatmen kann – im wahrsten Sinne des Wortes.
Eine Region lernt zu atmen
Die Lausitz heute ist eine Region, die langsam lernt, wieder tief durchzuatmen. Die Luft wird klarer, die Zukunft grüner, die Hoffnung größer. Doch in den Lungen der Menschen bleibt das Erbe – ein unsichtbares Archiv aus Staub, Schadstoffen und Jahrzehnten der Exposition.
Die Geschichte der Lausitz ist auch eine Geschichte über das Recht auf saubere Luft, über die Kosten des Fortschritts, über die Frage, wer zahlt, wenn Industrien gehen und Krankheiten bleiben. Es ist eine Geschichte, die noch nicht zu Ende erzählt ist – weil sie in jedem Atemzug weiterlebt, heute, morgen, in den Jahren, die kommen werden.